Backsteinbau
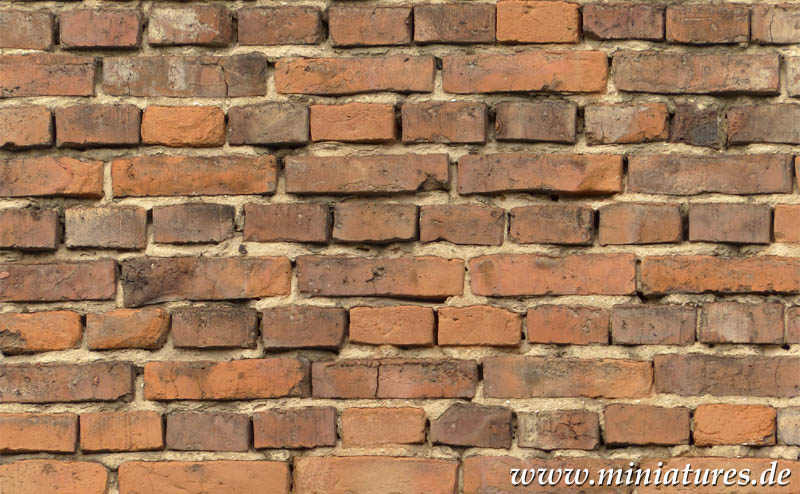
Backsteinbau (Backsteinrohbau, Ziegelrohbau, Rohbau), im Gegensatz zum Werkstein- und Putzbau diejenige Bauweise, bei der die massiven Teile des Bauwerkes ganz oder bis auf geringfügige Einzelheiten aus Mauersteinen hergestellt und im Äußeren nicht verputzt werden. Der Backsteinbau gehört zwar schon älteren und ältesten Bauzeiten (z. B. der mesopotamischen) an, ist aber zu besonderer Entwicklung und hoher Vollendung erst im Mittelalter gelangt, und zwar in Ländern, denen es an natürlichen Steinen gebricht, so in Oberitalien, in den Niederlanden, in der norddeutschen Tiefebene etc.
Die Mauersteine haben in Deutschland heute in der Regel das Normalformat von 25 : 12 : 6,5 cm. Im Mittelalter war das Format größer, etwa 28,5 : 13,5 : 9 cm, worauf die Schönheit der damaligen Bauten wesentlich mit beruht. Charakteristisch für den Backsteinbau ist Einschränkung in der Gliederung. Die Massenauflösung ist geringer als beim Hausteinbau, die Zahl der Gesimsteilungen wird eingeschränkt, das Maßwerk wird sehr viel einfacher, der freie ornamentale Schmuck tritt stark zurück. Als Ersatz sind Musterungen mit verschiedenfarbigen, oft glasierten Steinen gebräuchlich, ferner Gliederung der Flächen durch geputzte, manchmal mit Bemalung, Kratzmustern etc. geschmückte Blenden, Bereicherung der Gesimse durch Friese aus Platten oder Formsteinen auf Putzgrund u. dgl. m.
Ornamentierte Einzelheiten, wie Kapitelle, Basen, Kragsteine, Schlusssteine, Fialen, auch Figürliches, werden wohl als größere gebrannte Stücke (Terrakotten), meist aber aus Werkstein, im Innern – bei Monumentalbauten wird der Backsteinbau auch ins Innere gezogen – auch aus Stuck gefertigt.
In England mauert man mit Vorliebe alle Gliederungen und Ornamente in gewöhnlichen Steinen vor und meißelt aus diesen an der Fassade die beabsichtigten Formen heraus. Sind die geschilderten Ausbildungsweisen für den nordischen Backsteinbau charakteristisch, so hat sich in Oberitalien und neuerdings auch in England der Terrakottabau entwickelt, wobei an Stelle des Formsteins die oft ziemlich großen, dann hohlen und meist reichen Terrakotten treten. Schließlich ist, besonders in den Niederlanden, eine gemischte Backsteinbauweise herausgebildet worden, bei der nur die Flächen in Backsteinbau, Gesimse, Fenster- und Türgewände etc. in Werkstein ausgeführt werden.
Zur bedeutsamsten Entfaltung kam der Backsteinbau, wie alle mittelalterliche Architektur, im Kirchenbau; doch sind uns auch in Schlössern, Rathäusern und besonders in Tortürmen, ja selbst in Wohnhäusern hervorragende Backsteinbaudenkmäler erhalten. Dem Kunstgeschmack des 17. und 18. Jahrhunderts sagte der Backsteinbau wenig zu. Seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bedient man sich in Deutschland bald dieser, bald jener der überkommenen Weisen. Besonders gepflegt wurde der Backsteinbau durch die Schulen von Hannover und Berlin. In neuerer Zeit ging man einerseits wieder mehr auf die schlichte und gesunde Bauweise der norddeutschen Tiefebene, vor allem der Mark Brandenburg, anderseits auf den gemischten Backsteinbau zurück. Nach beiden Richtungen sind die Erfolge nicht ausgeblieben; nur krankt der moderne Backsteinbau noch an zwei Grundübeln: am kleinen Format und an dem der Front nachträglich vorgeklebten Verblendstein. Durch jenes kommt kleinlicher Maßstab in die Bauwerke, durch diesen eine glatte Gelecktheit, deren ungünstige Wirkung durch die gewöhnlich beliebte kleine, bis zur Unsichtbarkeit gefärbte Fuge noch verschlechtert wird.
Bibliographie
- Adler: Mittelalterliche Backsteinbauwerke des preußischen Staates (Berl. 1862–98)
- Essenwein, v.:, Norddeutschlands Backsteinbau im Mittelalter (Karlsr. 1855)
- Gottlob: Formenlehre der norddeutschen Backsteingotik (Leipz. 1900)
- Haupt: Backsteinbauten der Renaissance in Deutschland (Frankf. a. M. 1899)
- Lutsch: Backsteinbauten Mittelpommerns (Berl. 1890)
- Runge: Beiträge zur Kenntnis der Backsteinarchitektur Italiens (Berl. 1847 und 1853)
- Stiehl: Der Backsteinbau romanischer Zeit etc. (Leipz. 1898)
- Strack: Ziegelbauwerke des Mittelalters u. der Renaissance in Italien (Berl. 1889)
Quelle: Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage 1905–1909